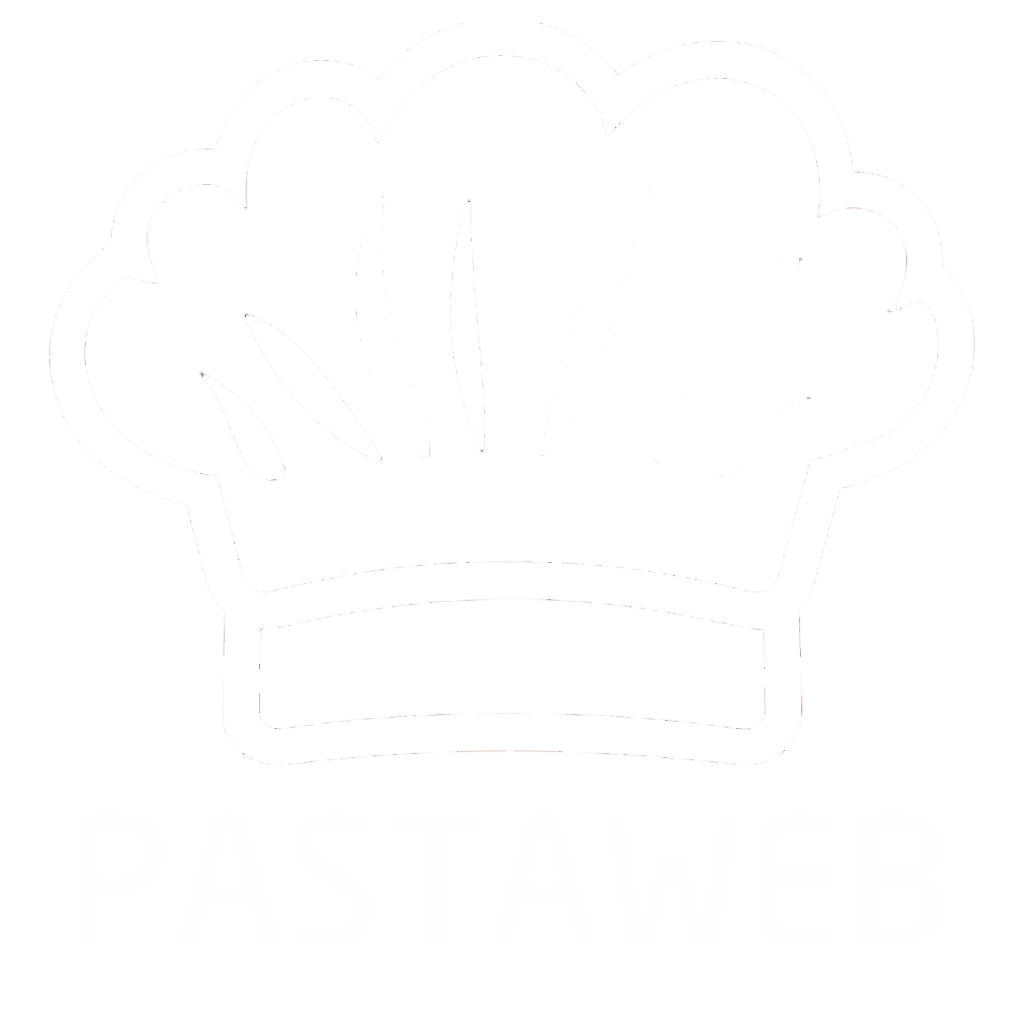Schnellanleitung
-
1
Waschen & Putzen: Rhabarberstangen unter kaltem Wasser gründlich waschen und trocknen. 💡 Tipp: Hartnäckigen Schmutz mit einer Gemüsebürste entfernen.
-
2
Blätter entfernen: Die Blätter und Blattansätze vollständig abschneiden und entsorgen. ⚠️ Wichtig: Die Blätter sind aufgrund hoher Oxalsäurekonzentration giftig.
-
3
Enden abschneiden: Das untere, oft trockene oder holzige Ende (ca. 1-2 cm) großzügig entfernen.
-
4
Schälen (bei Bedarf): Bei dicken, faserigen Stangen die harten Außenfäden mit einem Sparschäler oder Messer abziehen. Junge, zarte Stangen müssen nicht geschält werden. 💡 Test: Wenn sich die Fäden leicht und dick abziehen lassen, ist Schälen ratsam.
-
5
Schneiden: Die vorbereiteten Stangen in die für das Rezept gewünschte Größe schneiden (z. B. 1-2 cm Stücke für Kompott).
Rhabarber kündigt mit seinen leuchtend roten und grünen Stangen unverkennbar den Frühling an. Botanisch ein Gemüse, wird er in der Küche meist wie Obst behandelt und ist die Hauptzutat für unzählige Kuchen, Kompotte und Desserts. Sein charakteristisches Aroma ist eine faszinierende Mischung aus intensiver Säure und fruchtiger Frische, die in der warmen Jahreszeit für eine willkommene Abwechslung sorgt. Doch bevor man in den Genuss dieser Delikatesse kommt, steht die richtige Vorbereitung an – ein Schritt, der über das Gelingen des gesamten Gerichts entscheidet.
Die korrekte Handhabung von Rhabarber ist mehr als nur einfaches Waschen und Schneiden. Sie ist der Schlüssel, um eine faserige, zähe Konsistenz zu vermeiden und stattdessen ein zartes, aromatisches Ergebnis zu erzielen. Viele schrecken vor der Zubereitung zurück, aus Sorge vor zu viel Säure, einer wässrigen Konsistenz im Kuchen oder dem Umgang mit den berüchtigten Fasern. Dabei sind es oft nur kleine Kniffe und das Wissen um die Beschaffenheit der Pflanze, die den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem herausragenden Rhabarbergericht ausmachen.
Dieser Artikel beleuchtet alle Aspekte der Rhabarber-Vorbereitung im Detail. Von der Auswahl der richtigen Stangen auf dem Markt über das sichere Entfernen der giftigen Blätter bis hin zur entscheidenden Frage, ob und wie man Rhabarber schälen sollte. Darüber hinaus werden Schnitttechniken für verschiedene Verwendungszwecke, der Umgang mit der enthaltenen Oxalsäure und die besten Methoden zur Lagerung und Konservierung ausführlich erklärt, damit jede Zubereitung sicher und mühelos gelingt.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Qualität erkennen: Feste, glänzende Stangen mit frischen Schnittstellen sind ein Zeichen für Frische und Saftigkeit.
- Blätter sind giftig: Die Blätter des Rhabarbers enthalten eine hohe Konzentration an Oxalsäure und müssen restlos entfernt und entsorgt werden.
- Schälen nach Bedarf: Junge, dünne und rote Stangen müssen oft nicht geschält werden. Dicke, grüne und faserige Stangen hingegen schon, um eine zähe Textur zu vermeiden.
- Oxalsäure reduzieren: Durch Kochen, Blanchieren und die Kombination mit kalziumreichen Lebensmitteln wie Milchprodukten kann der Gehalt an verfügbarer Oxalsäure im Gericht verringert werden.
- Richtige Lagerung: In ein feuchtes Tuch gewickelt, bleibt Rhabarber im Gemüsefach des Kühlschranks mehrere Tage frisch. Zum Einfrieren eignet er sich ebenfalls hervorragend.
Die richtige Auswahl: Frischen Rhabarber erkennen und kaufen
Die Qualität des Endprodukts beginnt bereits beim Einkauf. Frischer, hochwertiger Rhabarber ist die Grundvoraussetzung für ein aromatisches und zartes Gericht. Beim Kauf sollte man auf mehrere Merkmale achten, die Aufschluss über den Zustand der Stangen geben. Die Stangen sollten sich fest und prall anfühlen und bei leichtem Biegen nicht nachgeben, sondern eher brechen. Eine glatte, glänzende Oberfläche ist ebenfalls ein Indikator für Frische. Matte, schrumpelige oder weiche Stellen deuten darauf hin, dass der Rhabarber schon länger liegt und an Feuchtigkeit verloren hat. Solche Stangen sind oft zäh und weniger saftig. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Schnittstellen an den Enden. Diese sollten feucht und frisch aussehen. Sind sie bereits stark ausgetrocknet, bräunlich verfärbt oder gar schimmelig, ist vom Kauf abzuraten.
Die Farbe des Rhabarbers gibt Auskunft über die Sorte und tendenziell auch über den Geschmack. Es gibt Sorten mit rein grünen Stangen und Fruchtfleisch, solche mit roter Schale und grünem Fruchtfleisch und durchgehend rot gefärbte Sorten, wie zum Beispiel ‚Holsteiner Blut‘. Generell gilt, dass rotschalige Sorten milder im Geschmack und weniger säurehaltig sind als ihre grünen Verwandten. Die intensive rote Farbe, die besonders in Konfitüren oder Grützen geschätzt wird, sitzt hauptsächlich in der Schale. Grünstieliger Rhabarber ist oft kräftiger und saurer im Geschmack, was von manchen Köchen für bestimmte Rezepte bevorzugt wird, da die Säure einen guten Kontrapunkt zu süßen Komponenten bildet. Die Wahl zwischen roten und grünen Sorten ist also letztlich eine Frage der persönlichen Vorliebe und des geplanten Gerichts.
Auch die Dicke der Stangen spielt eine Rolle bei der Auswahl und der späteren Verarbeitung. Junge, dünne Stangen, die oft zu Beginn der Saison erhältlich sind, sind in der Regel zarter und weniger faserig. Ihr großer Vorteil ist, dass sie häufig nicht oder nur sehr sparsam geschält werden müssen, wodurch Arbeitszeit gespart und mehr von der farb- und geschmacksintensiven Schale erhalten bleibt. Dickere Stangen sind zwar ergiebiger, neigen aber stärker zur Faserbildung. Sie müssen fast immer geschält werden, um eine unangenehm zähe Konsistenz zu vermeiden. Es lohnt sich also, beim Einkauf gezielt nach den schlankeren Exemplaren Ausschau zu halten, besonders wenn man ein feines Kompott oder einen zarten Kuchenbelag plant.
Die Rhabarbersaison ist kurz und dauert in der Regel von April bis zum 24. Juni, dem Johannistag. Diese traditionelle Befristung hat einen guten Grund: Zum einen benötigt die Pflanze nach diesem Datum Zeit, um sich zu regenerieren und Kraft für das nächste Jahr zu sammeln. Zum anderen steigt der Gehalt an Oxalsäure in den Stangen im Laufe der Saison an. Ein höherer Oxalsäuregehalt macht den Rhabarber nicht nur saurer im Geschmack, sondern kann auch gesundheitlich bedenklich sein. Daher wird empfohlen, die Ernte und den Verzehr nach dem Johannistag einzustellen. Wer auch außerhalb der Saison nicht auf Rhabarber verzichten möchte, sollte ihn während der Hauptsaison kaufen und für später einfrieren.
Gut zu wissen: Der Johannistag und die Rhabarber-Regel
Die Bauernregel, die Rhabarberernte am 24. Juni (Johannistag) zu beenden, dient dem Schutz der Pflanze und der Gesundheit. Die Pflanze nutzt den Rest des Sommers, um durch Photosynthese genügend Energie in ihren Wurzeln zu speichern, damit sie im nächsten Frühjahr wieder kräftig austreiben kann. Gleichzeitig nimmt die Konzentration der Oxalsäure in den Stielen zu, was den Geschmack beeinträchtigt und bei übermäßigem Verzehr die Kalziumaufnahme im Körper hemmen kann.
| Eigenschaft | Roter Rhabarber (z.B. Himbeerrhabarber) | Grüner Rhabarber |
|---|---|---|
| Geschmack | Mild, fruchtig, geringerer Säuregehalt | Kräftig, ausgeprägt sauer |
| Fasergehalt | Meist geringer, besonders bei jungen Stangen | Oft höher, neigt eher zur Faserigkeit |
| Schälen | Oft nicht notwendig, um Farbe zu erhalten | Fast immer empfohlen |
| Beste Verwendung | Desserts, Kuchen, Grütze (für eine schöne Farbe) | Konfitüren, Chutneys, herzhafte Gerichte |
Grundlegende Vorbereitung: Waschen, Putzen und Enden entfernen
Der erste und wichtigste Schritt jeder Rhabarber-Zubereitung ist die gründliche Reinigung. Da die Stangen bodennah wachsen, haften oft Erd- und Sandreste an ihnen, besonders im unteren Bereich. Man sollte die Stangen einzeln unter kaltem, fließendem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine weiche Gemüsebürste vorsichtig eingesetzt werden. Es ist wichtig, den Rhabarber nicht zu lange im Wasser liegen zu lassen, da er sonst Wasser aufsaugen und an Aroma verlieren kann. Nach dem Waschen sollten die Stangen mit einem sauberen Küchentuch oder Küchenpapier sorgfältig trocken getupft werden. Eine saubere Basis ist entscheidend, nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern auch, weil verbleibende Schmutzpartikel den Geschmack des fertigen Gerichts negativ beeinflussen können.
Ein absolut kritischer Schritt bei der Vorbereitung ist das Entfernen der Blätter. Rhabarberblätter enthalten eine sehr hohe Konzentration an Oxalsäure und anderen toxischen Substanzen und sind daher giftig. Sie dürfen unter keinen Umständen verzehrt werden. Man schneidet die Blätter mit einem scharfen Messer direkt am Stielansatz großzügig ab. Auch die leicht gekräuselten, rötlichen Blattansätze sollten vollständig entfernt werden, da auch hier die Oxalsäurekonzentration erhöht ist. Die entfernten Blätter sollten umgehend und sicher entsorgt werden, insbesondere so, dass sie für Kinder oder Haustiere nicht zugänglich sind. Sie gehören nicht auf den Kompost, da die toxischen Stoffe dort nur langsam abgebaut werden und in den Kreislauf gelangen könnten.
Nachdem die Blätter entfernt wurden, widmet man sich den Enden der Stangen. Das untere Ende, mit dem die Stange aus dem Boden wuchs, ist meist trocken, holzig und faserig. Dieses sollte man großzügig, etwa ein bis zwei Zentimeter weit, abschneiden, bis man auf saftiges, frisches Gewebe stößt. Auch das obere Ende, an dem das Blatt saß, wird noch einmal sauber nachgeschnitten, um sicherzustellen, dass alle Blattreste entfernt sind. Diese Vorbereitungsschritte stellen sicher, dass nur die zarten und genießbaren Teile der Rhabarberstange in die weitere Verarbeitung gelangen. Ein sauberes und präzises Vorgehen hier legt den Grundstein für ein perfektes Endergebnis.
Für alle Schneidarbeiten ist die Verwendung von geeignetem Werkzeug entscheidend. Ein scharfes Küchenmesser ist einem stumpfen Messer immer vorzuziehen. Ein stumpfes Messer quetscht die Pflanzenfasern, anstatt sie sauber zu durchtrennen. Dies kann dazu führen, dass die Stangen beim Schneiden ausfransen und die Fasern stärker hervortreten, was die Textur negativ beeinflusst. Als Unterlage eignet sich ein stabiles Schneidebrett aus Holz oder Kunststoff. Man sollte bedenken, dass der Saft von rotem Rhabarber, ähnlich wie bei Roter Bete, auf hellen Oberflächen Flecken hinterlassen kann. Diese lassen sich aber in der Regel mit etwas Zitronensaft oder einer Paste aus Backpulver und Wasser wieder entfernen.
Achtung: Rhabarberblätter sind giftig!
Verzehren Sie niemals Rhabarberblätter oder Blattansätze. Sie enthalten eine hohe Konzentration an Oxalsäure und Anthrachinon-Glykosiden, die zu schweren Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen und im schlimmsten Fall zu Nierenschäden führen können. Entsorgen Sie die Blätter stets im Restmüll und nicht auf dem Kompost.
Das Schälen: Wann es notwendig ist und wie es richtig gelingt
Die Frage, ob Rhabarber geschält werden muss, ist eine der am häufigsten gestellten und sorgt oft für Unsicherheit. Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn die Notwendigkeit hängt stark von der Sorte, dem Alter und der Dicke der Stangen ab. Als Faustregel gilt: Junge, dünne und zarte Rhabarberstangen, insbesondere die roten Sorten vom Anfang der Saison, müssen oft nicht geschält werden. Ihre Schale ist meist noch weich genug, um beim Kochen oder Backen zart zu werden. Zudem sitzt ein Großteil der roten Farbe und auch viel Aroma direkt unter und in der Schale. Ein Schälen würde hier zu einem Verlust an Geschmack und einer weniger ansprechenden, blasseren Farbe des Gerichts führen. Man sollte diese Stangen also lediglich gründlich waschen und die Enden abschneiden.
Bei dickeren, älteren oder sehr grünen Stangen sieht die Sache anders aus. Diese entwickeln im Laufe ihres Wachstums eine dicke, faserige Außenschicht. Diese Fasern, botanisch gesehen die Leitbündel der Pflanze, werden beim Kochen nicht weich und führen zu einer unangenehm zähen, „fädrigen“ Textur im Mund. Um dies zu vermeiden, ist das Schälen hier unerlässlich. Einen einfachen Test kann man durchführen, indem man mit einem kleinen Messer am Ende der Stange ansetzt und versucht, einen Streifen der Schale abzuziehen. Löst sich dieser leicht und fühlt er sich wie ein dicker, harter Faden an, sollte die gesamte Stange geschält werden. Ein weiteres Indiz ist das leichte Biegen der Stange: Knackt die äußere Schicht dabei hörbar und es zeigen sich deutliche Fasern, ist Schälen die richtige Entscheidung.
Für das Schälen selbst gibt es zwei bewährte Methoden. Die erste und schnellste Methode ist die Verwendung eines Sparschälers. Man setzt am oberen oder unteren Ende an und zieht den Schäler in langen Bahnen über die Stange. Dabei sollte man darauf achten, nur die äußere, faserige Schicht zu entfernen und so wenig wie möglich vom wertvollen Fruchtfleisch abzutragen. Die zweite, etwas präzisere Methode eignet sich besonders für unebene Stangen: Man setzt mit einem kleinen, scharfen Küchenmesser (Tourniermesser) am Ende der Stange an, löst einen Streifen der Schale und zieht diesen dann langsam und kontrolliert über die gesamte Länge der Stange ab. So wiederholt man den Vorgang rundherum, bis alle zähen Fasern entfernt sind. Man wird schnell merken, dass sich die Fasern fast von selbst abziehen lassen.
Was passiert, wenn man faserigen Rhabarber nicht schält? Das Ergebnis kann kulinarisch enttäuschend sein. Während der Geschmack vielleicht noch stimmt, wird die Textur des Gerichts durch die ungenießbaren Fäden stark beeinträchtigt. Besonders in feinen Zubereitungen wie Kompott, Grütze oder auf einem Kuchenbelag stören die zähen Fasern erheblich. Sie wickeln sich um den Löffel oder bleiben zwischen den Zähnen hängen. Selbst langes Kochen kann diese Fasern nicht vollständig zersetzen. Einzige Ausnahme: Wenn man Rhabarber nur zur Saft- oder Sirupgewinnung auskocht und die festen Bestandteile anschließend durch ein Sieb passiert, ist das Schälen weniger kritisch, da die Fasern zusammen mit dem restlichen Fruchtfleisch entfernt werden.
Profi-Tipp: Farbe erhalten trotz Schälens
Wenn Sie roten Rhabarber schälen müssen, aber die schöne Farbe nicht verlieren wollen, gibt es einen Trick: Geben Sie ein oder zwei Stücke der roten Schale während des Kochens mit in den Topf. Die Farbstoffe lösen sich und färben das Kompott oder die Grütze intensiv rot. Entfernen Sie die Schalenstücke einfach vor dem Servieren wieder.
-
✓
Test durchführen: Einen kleinen Streifen Schale am Ende abziehen. Ist er dick und faserig?
-
→
Ja, faserig: Die Stangen mit einem Sparschäler oder Messer schälen, bis alle harten Fäden entfernt sind.
-
→
Nein, zart: Schälen ist nicht notwendig. Nur waschen und Enden abschneiden.
Richtig schneiden: Techniken für verschiedene Gerichte
Nach dem Schälen folgt das Schneiden. Die Art und Weise, wie Rhabarber geschnitten wird, hat einen direkten Einfluss auf die Garzeit und die Textur des fertigen Gerichts. Die wichtigste Grundregel lautet: Für ein gleichmäßiges Koch- oder Backergebnis sollten die Stücke immer eine annähernd gleiche Größe haben. Wenn die Stücke stark in der Größe variieren, werden die kleinen bereits zu Mus zerfallen sein, während die großen noch hart und untergart sind. Dies ist besonders bei Kuchen, Crumbles oder Kompott von Bedeutung, wo eine konsistente Textur gewünscht ist. Man sollte sich also einen Moment Zeit nehmen, um die vorbereiteten Stangen sorgfältig und gleichmäßig zu portionieren.
Die ideale Schnittgröße hängt stark von der geplanten Verwendung ab. Für Kompott, Konfitüre oder Grütze, bei denen der Rhabarber zerfallen soll, eignen sich kleine Stücke von etwa 1 bis 2 Zentimetern Länge. Durch die größere Oberfläche garen sie schneller und zerfallen leichter zu einem homogenen Mus. Für Kuchen, Tartelettes oder Crumbles, bei denen die Rhabarberstücke noch als solche erkennbar sein und etwas Biss behalten sollen, sind größere Stücke von 3 bis 5 Zentimetern besser geeignet. Für eine besonders dekorative Optik auf Blechkuchen oder in Tartes kann man die Stangen auch in sehr lange Stücke schneiden, die der Länge oder Breite der Backform entsprechen, und sie in einem Muster anordnen.
Ein häufiges Problem beim Backen mit Rhabarber ist sein hoher Wassergehalt. Während des Backens tritt viel Flüssigkeit aus, die den Kuchenteig durchweichen und matschig machen kann. Um dies zu verhindern, gibt es einen bewährten Trick: Man mischt die geschnittenen Rhabarberstücke in einer Schüssel mit etwas Zucker (und optional etwas Stärke) und lässt sie für etwa 15 bis 30 Minuten stehen. Der Zucker entzieht dem Rhabarber durch Osmose einen Teil des Zellsafts. Diesen ausgetretenen Saft gießt man vor der Weiterverarbeitung ab. So wird der Rhabarber „entwässert“ und der Kuchenboden bleibt schön trocken. Eine andere Methode ist, den Kuchenboden vor dem Belegen mit Rhabarber mit einer dünnen Schicht Semmelbrösel, gemahlenen Nüssen oder Sahnesteif zu bestreuen, die die austretende Flüssigkeit aufsaugen.
Für herzhafte Gerichte oder Salate kann Rhabarber auch anders geschnitten werden. Dünne, schräg geschnittene Scheiben (auf Bias) garen sehr schnell und sehen elegant aus. Sie eignen sich gut zum kurzen Anbraten in einer Pfanne für ein Chutney oder als säuerliche Komponente in einem Wok-Gericht. Man kann Rhabarber auch mit einem Sparschäler in lange, dünne Bänder hobeln. Diese „Rhabarber-Tagliatelle“ können kurz blanchiert und als Beilage serviert oder roh in einem Salat mariniert werden. Die Vielseitigkeit in den Schnitttechniken eröffnet ein breites Spektrum an kulinarischen Möglichkeiten jenseits der klassischen Süßspeisen.
Schnitttechniken und ihre Verwendung
| Schnitttechnik | Größe | Ideal für… | Effekt |
|---|---|---|---|
| Kleine Stücke | 1-2 cm | Kompott, Konfitüre, Füllungen | Zerfällt schnell und gleichmäßig |
| Große Stücke | 3-5 cm | Kuchen, Crumbles, Aufläufe | Bleibt stückig und behält Biss |
| Lange Stangen | 5+ cm | Dekorative Kuchen, Tartes | Sehr ansprechende Optik, bleibt fest |
| Dünne Scheiben (schräg) | 2-3 mm | Chutneys, Pfannengerichte, Salate | Gart sehr schnell, elegante Form |
Oxalsäure im Rhabarber: Was man wissen und beachten muss
Rhabarber verdankt seinen charakteristisch sauren Geschmack unter anderem der enthaltenen Oxalsäure. Diese organische Säure kommt in vielen Pflanzen natürlich vor und dient ihnen als Schutzmechanismus gegen Fressfeinde. Im menschlichen Körper kann Oxalsäure in größeren Mengen jedoch problematisch sein. Sie hat die Eigenschaft, Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Eisen zu binden. Diese gebundenen Mineralstoffe (Oxalate) kann der Körper nicht mehr aufnehmen. Dies ist auch der Grund für das manchmal stumpfe, „pelzige“ Gefühl auf den Zähnen nach dem Verzehr von Rhabarber: Die Oxalsäure reagiert mit dem Kalzium im Speichel und bildet winzige Kristalle auf der Zahnoberfläche.
Für gesunde Menschen ist der moderate Verzehr von gekochtem Rhabarber während der Saison in der Regel unbedenklich. Personen, die jedoch zu Nierensteinen (insbesondere Kalziumoxalat-Steinen) neigen, an Gicht oder rheumatischen Erkrankungen leiden, sollten beim Rhabarberverzehr vorsichtig sein oder ärztlichen Rat einholen. Die Oxalate können die Bildung von Nierensteinen begünstigen. Der Gehalt an Oxalsäure ist in den verschiedenen Teilen der Pflanze sehr unterschiedlich. Am höchsten ist er in den giftigen Blättern. In den Stangen nimmt die Konzentration vom Blattansatz zur Basis hin ab und steigt im Verlauf der Saison bis zum Johannistag deutlich an.
Glücklicherweise gibt es mehrere effektive Methoden, den Gehalt an verfügbarer Oxalsäure im fertigen Gericht deutlich zu reduzieren. Die wichtigste Maßnahme ist das Erhitzen. Oxalsäure ist wasserlöslich, daher geht beim Kochen oder Blanchieren ein Teil davon in das Kochwasser über. Wenn man dieses Wasser anschließend wegschüttet, wird ein signifikanter Anteil der Säure entfernt. Auch das Schälen des Rhabarbers hilft, da die Konzentration in der Schale tendenziell höher ist. Die Auswahl von jungen, roten Sorten zu Beginn der Saison ist ebenfalls vorteilhaft, da diese von Natur aus weniger Oxalsäure enthalten als ältere, grüne Stangen.
Ein besonders bewährter und genussvoller Trick aus der traditionellen Küche ist die Kombination von Rhabarber mit kalziumreichen Lebensmitteln. Das Kalzium aus Milch, Joghurt, Quark, Sahne oder Vanillesoße bindet die Oxalsäure bereits im Magen-Darm-Trakt. Die entstehenden Kalziumoxalat-Kristalle sind zu groß, um über die Darmwand aufgenommen zu werden, und werden einfach wieder ausgeschieden. So wird verhindert, dass die Oxalsäure dem Körper Kalzium entzieht oder die Nieren belastet. Die klassische Kombination von Rhabarberkompott mit Vanillesoße oder Rhabarberkuchen mit einem Klecks Sahne ist also nicht nur geschmacklich harmonisch, sondern auch aus ernährungsphysiologischer Sicht sinnvoll.
Zusammenfassung: Oxalsäure reduzieren
- Erhitzen: Rhabarber immer kochen, backen oder blanchieren.
- Kochwasser verwerfen: Beim Kochen in Wasser dieses anschließend wegschütten.
- Schälen: Besonders bei dicken und grünen Stangen die Schale entfernen.
- Sorte und Saison beachten: Junge, rote Stangen aus der Frühernte bevorzugen.
- Mit Milchprodukten kombinieren: Mit Joghurt, Quark, Sahne oder Milch servieren, um die Säure zu binden.
Lagerung und Haltbarkeit: Rhabarber richtig aufbewahren
Rhabarber sollte am besten so frisch wie möglich verarbeitet werden, da er dann am saftigsten und aromatischsten ist. Muss er doch einmal für einige Tage aufbewahrt werden, gibt es eine einfache Methode, um ihn knackig zu halten. Man wickelt die ungewaschenen und ungeschnittenen Stangen in ein feuchtes Küchentuch. Das Tuch verhindert, dass der Rhabarber austrocknet. So vorbereitet, kann er im Gemüsefach des Kühlschranks für etwa drei bis fünf Tage gelagert werden, ohne nennenswert an Qualität zu verlieren. Von einer Lagerung in Plastiktüten ist abzuraten, da sich darin Kondenswasser bilden kann, was die Fäulnis begünstigt. Rhabarber sollte erst unmittelbar vor der Zubereitung gewaschen werden.
Bereits geschnittener Rhabarber ist deutlich kürzer haltbar. Durch die Schnittflächen verliert er schnell an Feuchtigkeit und ist anfälliger für mikrobiellen Verderb. Falls man Rhabarber vorschneiden muss, sollte man die Stücke in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren und idealerweise innerhalb von ein bis zwei Tagen verbrauchen. Man wird feststellen, dass die Schnittflächen sich leicht verfärben und die Stücke etwas an Saftigkeit einbüßen, für gekochte Gerichte ist dies aber meist noch akzeptabel.
Für eine langfristige Aufbewahrung über die Saison hinaus ist das Einfrieren die beste Methode. Rhabarber lässt sich hervorragend konservieren und behält dabei sein typisches Aroma. Zuerst wird der Rhabarber wie gewohnt vorbereitet: waschen, putzen, schälen (falls nötig) und in die gewünschte Stückgröße schneiden. Ein entscheidender Schritt für ein gutes Ergebnis ist das sorgfältige Trocknen der Stücke. Anschließend breitet man die Rhabarberstücke auf einem Backblech oder einem großen Teller so aus, dass sie sich nicht berühren, und stellt sie für etwa ein bis zwei Stunden in den Gefrierschrank. Durch dieses „Vor- oder Schockfrosten“ gefriert jedes Stück einzeln und sie kleben später im Gefrierbeutel nicht zu einem großen Klumpen zusammen.
Nach dem Vorfrosten werden die festen Rhabarberstücke in Gefrierbeutel oder geeignete Dosen umgefüllt. Man sollte versuchen, so viel Luft wie möglich aus den Beuteln zu drücken, um Gefrierbrand zu minimieren. Gut verpackt ist der Rhabarber im Gefrierschrank etwa 8 bis 12 Monate haltbar. Für die meisten Rezepte, wie Kompott, Grütze oder Crumble, kann der Rhabarber direkt im gefrorenen Zustand verwendet werden. Man gibt ihn einfach gefroren in den Topf oder die Auflaufform. Ein vorheriges Auftauen ist nicht nötig und auch nicht empfehlenswert, da die Stücke dabei sehr weich und matschig werden. Für Kuchen sollte man die gefrorenen Stücke eventuell mit etwas Stärke mischen, um die zusätzlich austretende Flüssigkeit zu binden.
| Lagerungsmethode | Dauer | Zustand des Rhabarbers | Optimal für |
|---|---|---|---|
| Raumtemperatur | Max. 1 Tag | Ungewaschen, ungeschnitten | Sofortige Verarbeitung |
| Kühlschrank (in feuchtem Tuch) | 3-5 Tage | Ungewaschen, ungeschnitten | Kurzfristige Aufbewahrung |
| Kühlschrank (geschnitten, in Dose) | 1-2 Tage | Gewaschen, geschnitten | Vorbereitung für den nächsten Tag |
| Gefrierschrank | 8-12 Monate | Geputzt, geschnitten, vorgefrostet | Langfristige Konservierung |
Häufige Fragen zur Rhabarber-Vorbereitung
Kann man Rhabarber roh essen?
Grundsätzlich ist der rohe Verzehr von Rhabarberstangen in kleinen Mengen für gesunde Menschen möglich. Allerdings ist roher Rhabarber sehr sauer und hart. Zudem ist der Gehalt an Oxalsäure im rohen Zustand am höchsten. Durch Kochen oder Backen wird der Rhabarber nicht nur bekömmlicher und zarter, sondern auch der Oxalsäuregehalt wird reduziert. Traditionell werden rohe Stangen manchmal in Zucker gedippt und gegessen, dies sollte aber eine Ausnahme bleiben.
Warum endet die Rhabarbersaison am 24. Juni?
Diese traditionelle Regel hat zwei Hauptgründe. Erstens benötigt die mehrjährige Pflanze den Rest des Sommers, um durch Photosynthese in den Blättern genügend Energie zu produzieren und in ihren Wurzeln zu speichern. Dies sichert ein kräftiges Wachstum im nächsten Frühjahr. Zweitens steigt der Gehalt der gesundheitlich bedenklichen Oxalsäure in den Stangen im Laufe der Saison kontinuierlich an, was den Rhabarber saurer und weniger bekömmlich macht.
Ist Rhabarber Obst oder Gemüse?
Aus botanischer Sicht ist Rhabarber eindeutig ein Gemüse. Man verzehrt die Blattstiele der Pflanze, was ihn zu einem Stielgemüse macht, ähnlich wie Staudensellerie. In der Küche wird er jedoch aufgrund seines fruchtig-sauren Geschmacks und seiner Verwendung in süßen Speisen wie Kuchen, Kompott oder Konfitüre meist wie Obst behandelt. Man spricht hier von einer kulinarischen Einordnung als „Fruchtgemüse“.
Was tun, wenn der Rhabarberkuchen zu wässrig wird?
Um einen matschigen Kuchenboden zu vermeiden, kann man die geschnittenen Rhabarberstücke vor dem Belegen mit 1-2 Esslöffeln Zucker vermischen und etwa 15 Minuten stehen lassen. Den ausgetretenen Saft gießt man ab. Alternativ kann man den Teigboden vor dem Belegen mit einer dünnen Schicht Semmelbrösel, gemahlenen Mandeln oder Grieß bestreuen. Diese saugen die austretende Flüssigkeit während des Backens auf und schützen den Teig.
Hilft es, Rhabarber in Wasser zu legen?
Das Einlegen von Rhabarber in Wasser kann leicht welk gewordene Stangen kurzfristig wieder etwas praller und knackiger machen. Für die langfristige Lagerung ist diese Methode jedoch nicht geeignet, da die Stangen dabei wertvolle wasserlösliche Vitamine und Aromastoffe verlieren können. Besser ist die Lagerung in einem feuchten Tuch im Kühlschrank.
Fazit
Die richtige Vorbereitung von Rhabarber ist unkompliziert, wenn man die grundlegenden Eigenschaften der Pflanze kennt und beachtet. Sie ist der entscheidende Faktor, der über Textur, Geschmack und Bekömmlichkeit des fertigen Gerichts bestimmt. Die sorgfältige Auswahl frischer, praller Stangen legt den Grundstein für ein gelungenes Ergebnis. Das konsequente Entfernen der giftigen Blätter und das Putzen der Stangen sind unerlässliche Sicherheitsschritte, während die Entscheidung für oder gegen das Schälen von der jeweiligen Sorte und dem Zustand der Stangen abhängt und maßgeblich die Zartheit des Endprodukts beeinflusst.
Ein bewusstes Vorgehen beim Schneiden sorgt für gleichmäßiges Garen, und das Wissen um den Umgang mit der enthaltenen Oxalsäure ermöglicht einen unbeschwerten Genuss. Durch einfaches Kochen und die klassische Kombination mit kalziumreichen Milchprodukten lässt sich deren Wirkung leicht minimieren. Mit den richtigen Techniken zur Lagerung und zum Einfrieren kann die kurze Rhabarbersaison zudem problemlos verlängert werden. Wer diese Aspekte berücksichtigt, kann die einzigartige säuerlich-frische Note des Frühlingsgemüses in vollen Zügen genießen und wird mit perfekt zarten und aromatischen Gerichten belohnt.